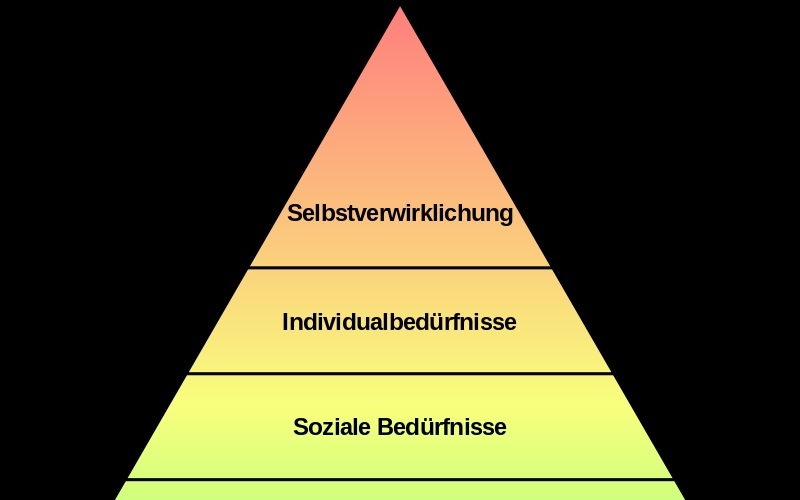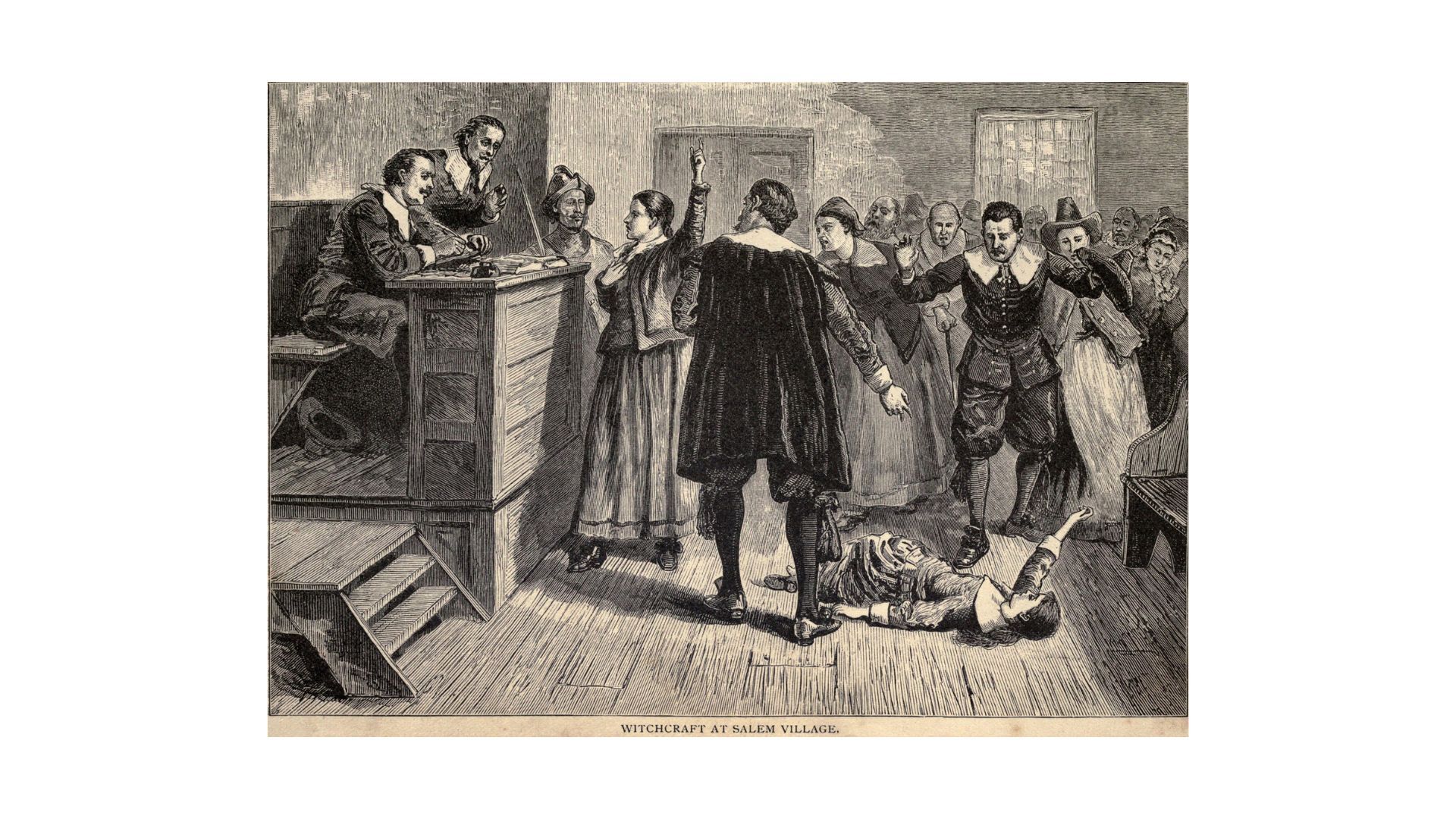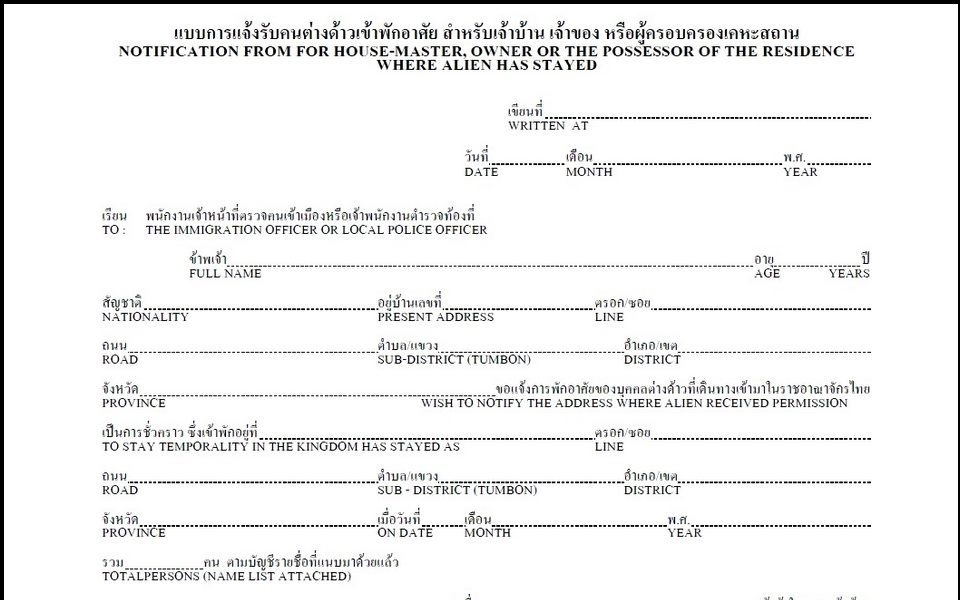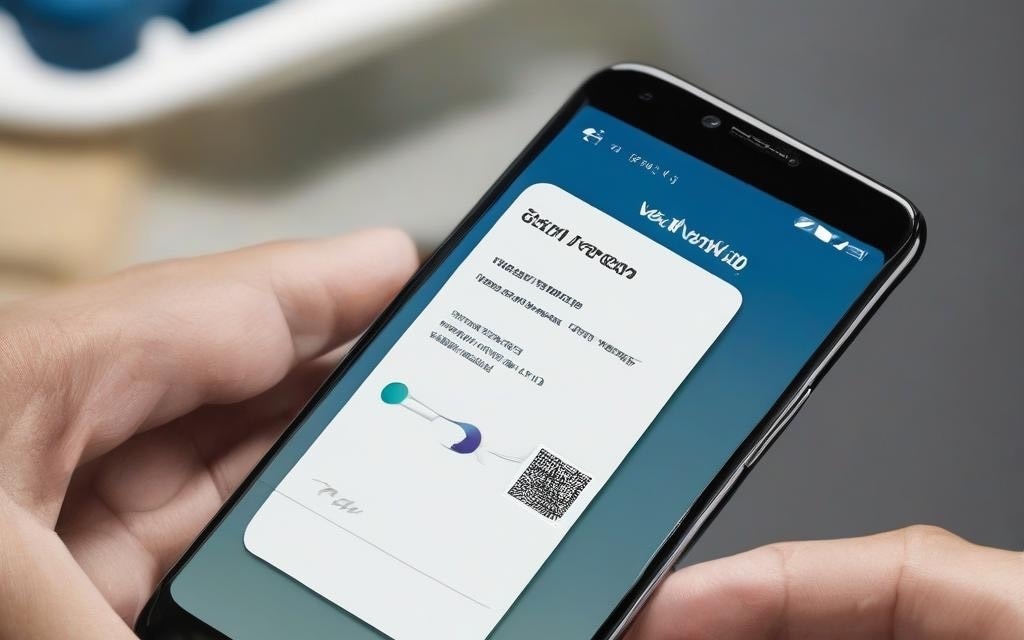Amnestie ist nicht Thailands Antwort

Do., 16. Feb. 2023 | Bangkok
Bangkok — Letzte Woche lehnte Premierminister General Prayut Chan-o-cha den Vorschlag für ein umfassendes Amnestiegesetz zur politischen Aussöhnung ab. Diese Idee geht auf einen früheren Vorschlag des ehemaligen Assistenten des stellvertretenden Premierministers Prawit Wongsuwan, Paisal Puechmongkol, zurück, wonach sich die von Prawit geführte Palang Pracharath Party für ein solches Gesetz einsetzen könnte.